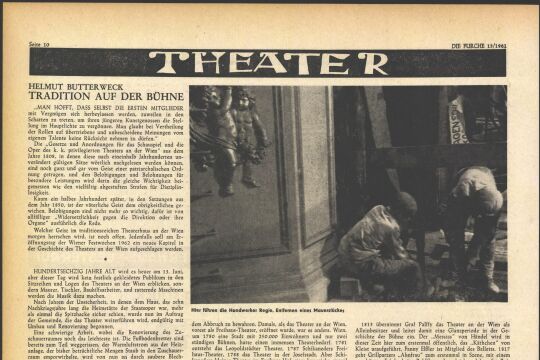Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Brave Sprechoper
Alle anderen spülen ihre Jahresbilanzen am Silvesterabend hinunter, nur das Theater blickt im Sommer zurück, wenn rundum alles an Wälder und ans Meer denkt. Welch guter Zeitpunkt für den Rückblick auf so wenig Rühmenswertes!
Manche Direktoren und Dramaturgen sind allerdings das ganze liebe Jahr lang Meister in der Kunst, über neuen Planungen das Gewesene zu verdrängen, vorhersehbar gewesene Blamagen wie Schläge blind wütenden Schicksals „wegzustecken” (ein wahrer Kraftakt verräterischer Fehlleistung, dieses beliebte Wort!) und mutig den Steinen zuzuschreiten, über die sie gestern auf die Nase gefallen sind und immer wieder zu stolpern gedenken, bis sie sie endlich ganz abgeschliffen haben.
Woran denkt man noch am Ende dieser Wiener Spielzeit, wenn man die Gastspiele deutscher Bühnen nicht einbezieht?
„Der Pflug und die Sterne” von Sean O'Casey (Burgtheater): Ja, da konnte man etwas über den Menschen im Bürgerkrieg erfahren, was so differenziert, mit so viel Menschenkenntnis und Poesie und doch so klar nachher kaum einer mehr gesagt hat. „Abendrot” von Gabriel Barylli (Schauspielhaus): Ja, da hat endlich wieder einmal einer bewiesen, wie unerhört aktuell ein Autor sein kann — wenn er darf. „Largo Desolato” von Vaclav Havel (Akademietheater): Ja, da werden endlich auch einmal die Probleme des Dissidenten als Integrationsfigur, die sich nicht verweigern darf, gezeigt.
Und sonst... ? Im Burgtheater platzt eine Seifenblase namens „Park”. Aber wie es um das Theater in deutscher Sprache wirklich steht, erwiesen zwei Stücke. Eines wurde im Volkstheater mit Erfolg gespielt, das andere verschwand in der Versenkung des Burgtheaters.
„Zwölfeläuten” von Heinz R. Unger würde verdienen, von vielen Theatern nachgespielt zu werden. Da wird gezeigt, wie liebe Dörfler 1945 schnell die Kurve kratzen, ehe die Russen da sind. Da wird der ewige Gegensatz von Humanismus und Opportunismus sichtbar, aber nur ganz kurz, dann wird alles wieder zuge-schmiert, Menschen, Menschen samma alle.
„Zwölfeläuten” markiert die Grenze, bis zu der ein Autor mit konkreter Kritik gehen darf, ohne sich für Wiens große Häuser zu disqualifizieren. (Aber viel besser schaut es auch anderswo nicht aus.) Tangiert er die popanzischen Instanzen aus einer Distanz von weniger als 40 Jahren, wird er dorthin abgedrängt, wo nichts passieren kann, in die Keller, bestenfalls schafft er den Sprung auf eine Mittelbühne.
Nähere Gegenwart, konkrete Wirklichkeit, zeigt sich auf den großen Wiener Bühnen schon lang nicht mehr, außer als tschechoslowakische Dissidentenliteratur. Die ist zwar wichtig, aber andererseits kann man damit Mut an den Tag legen, ohne ihn zu haben. Ist denn unsere westliche Gesellschaft um so vieles besser, daß sie eine so ernsthafte, konsequente, zu den Wurzeln der Zustände vorstoßende Kritik nicht braucht? Oder hat's unsere Politik mit all ihren unheimlichen Folge- und Begleiterscheinungen bloß geschafft, ihre hocheffizienten Wattewände, gegen die es sich viel schwerer anrennt als gegen die Kerkermauern sturer Despotien, auch um die Theater zu ziehen?
Nichts gegen Havels „Largo Desolato”, es ist ein gutes Stück. Bloß, sein nichtssagendes, aber in der CSSR halt auch verbotenes „Berghotel” wurde im Akademietheater vor wenigen Jahren ebenfalls gespielt, die „Judith” von Rolf Hochhuth hingegen nicht. Vom Burgtheater angenommen, aber hinter Nebelschwaden, die sich nie ganz hoben, „gescheitert”. Der schwarze Peter blieb dem Autor: Er hat's leider nicht geschafft, ein „unspielbares” Stück gemäß den Erwartungen des Hauses umzuschreiben. Ich schaffe es leider nicht, so ganz und gar zu glauben, ein Stück, in dem ein US-Präsident wegen der Produktion chemischer Waffen angeklagt und am Ende ermordet wird, sei wirklich nur aus künstlerischen Gründen auf der Strecke geblieben.
„Judith” hätte vielleicht einen Skandal entfesselt, war vielleicht nicht zu verantworten. Aber zuerst Mut zeigen, ein Stück annehmen, es dann doch nicht spielen und zuletzt nichts dafür können, Hase heißen: Nein!
Doch so sind sie, unsere großen Bühnen, und die mittleren weithin auch. Selbst ihre Alibis müssen „als Anachronismus dem aktuellen Bedürfnis nach gut konservierter, museumreifer .Moderne' rührend und rührig” entgegenkommen (Peter von Becker über „Mercedes” von Thomas Brasch).
Der große, große Rest: Stücke von Toten. Die homöopathische Interpretation der Gegenwart läßt sich mit Mitteln der Regie feiner dosieren als in einer Theaterlandschaft, die lebende und darum unberechenbare Dramatiker hochkommen läßt.
Ein solches Theater ist im Begriff, zur Sprechoper zu verkommen, zum Musentempel, zum Kult am Vergangenen, nur leider ohne Musik. Den Mächtigen hinter ihren Wattewänden ist dieses Thea^ ter viel Geld wert, es ist ja nicht ihres.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!