Reportage • Vor sechs Monaten hat das AKH die krebskranke Jenny "austherapiert“ entlassen. Seither fängt das mobile "Kinderhospiz Netz“ sie und ihre Familie auf.
Jenny ist ein Fan der Fernsehserie "Hannah Montana“ - wie Millionen andere Teenager auch. Ihre Stars sind Selena Gomez und Justin Bieber, ihre Leibspeise ist Vanillepudding (ohne Schlagobers!), und ihre Lieblingstiere sind jene drei Katzen, die gerade durchs Wohnzimmer schleichen. Auch die zwei Kaninchen draußen im kleinen Garten des Reihenhauses in der Wiener Donaustadt hat Jenny fest ins Herz geschlossen. Sie selbst hat sie schließlich ausgesucht - damals, als sie noch sehen konnte.
Heute ist Jenny blind und halbseitig gelähmt. Vielleicht hat der Tumor in ihrem Gehirn diese Behinderungen ausgelöst, vielleicht die Chemotherapie, die ihn vertreiben sollte; wahrscheinlich war es beides. Ihr zarter Körper ist auf eine Wechseldruckmatratze gebettet, um Wundliegen zu verhindern; ein Schlauch versorgt sie stündlich mit 30 Milliliter Kochsalzlösung, ein anderer leitet den Urin in einen Plastikbeutel ab. Pflaster sollen Jennys Schmerzen dämpfen, Astronautennahrung, Eiweiß, Bananen und Pudding sie bei Kräften halten.
"Tust du lauschen, Jenny?“
Meist scheint Jenny zu schlafen. Auch an diesem Nachmittag, als sich eine Gruppe von Frauen neben ihr im Wohnzimmer versammelt hat. Und doch ist die 14-Jährige hellwach: Manchmal öffnet sie die Augen, dann wieder bewegt sie die Arme. "Tust du lauschen, Jenny?“ fragt ihre Mutter und blickt lächelnd in die Damenrunde.
Mit ihr am Tisch sitzen zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des mobilen "Kinderhospiz Netz“, die gekommen sind, um sich vorzustellen: Da ist die erst 24-jährige Mihaela Rusu, die in einem Kindergarten arbeitet und bereits seit ihrem 19. Lebensjahr schwerkranke Kinder und ihre Familien betreut; und da ist die 50-jährige Gabriele Knapp, ehemals Abteilungsleiterin im AMS, die nach einer eigenen Erkrankung eine Aufgabe sucht, in der sie ihr Gespür für Menschen einbringen kann.
Beide Frauen haben den für Ehrenamtliche verpflichtenden Befähigungskurs des mobilen Kinderhospizes absolviert. Nun wollen sie für Familie S. "Inseln der Normalität“ schaffen: Indem sie mit Jennys jüngeren Brüdern Niko (9) und Basti (6) Hausübungen machen oder Karten-Türme bauen; indem sie Jenny den Klassiker "Der Kater Konstantin“ vorlesen, über den sie wegen ihres schlechten Kurzzeitgedächtnisses noch immer haltlos lachen kann, obwohl sie ihn schon zig Mal gehört hat; oder indem sie einfach da sind und zuhören. "Wir begleiten nicht das Sterben, sondern das Leben“, bringt es Sabine Reisinger auf den Punkt. Die ehemalige US-Botschaftsangestellte hat selbst vor 16 Jahren ihre damals 66 Tage alte Tochter verloren. Das schwerkranke Baby starb auf der Intensivstation; sie zu Hause zu betreuen, war auf Grund des fehlenden Unterstützungsangebots unmöglich. Geprägt von dieser Erfahrung machte Reisinger die Ausbildung zur Lebensberaterin und gründete schließlich 2005 gemeinsam mit der Ärztin Brigitte Humer-Tischler das österreichweit erste, mobile Kinderhospiz - das sich bis heute nur durch Spenden finanziert. Im März begann mit dem mobilen Kinderhospiz "MOMO“ eine ähnliche Einrichtung. Doch eine öffentliche Finanzierung der palliativen Versorgung unheilbarer kranker Kinder - pro Jahr sterben rund 400 in Österreich - fehlt noch immer.
Auch die Eltern bräuchten dringend Unterstützung: Laut einer Studie sind fünf Jahre nach dem Tod eines kranken Kindes 95 Prozent der Beziehungen zerbrochen. Umso wichtiger ist Entlastung - und das Engagement von Freiwilligen: "Die Ehrenamtlichen sind unbezahlbar“, weiß Sabine Reisinger. "Diese teils jahrelange Betreuung könnte man sonst nie finanzieren.“
Entlastung, um kurz abzutauchen
Nun sitzt sie mit zwei dieser unbezahlbaren Menschen im Wohnzimmer von Familie S. und bespricht mit Jennys alleinerziehender Mutter, wann und wie sie Hilfe braucht: um etwa ihre Schwester zu besuchen, was sie seit eineinhalb Jahren nicht geschafft hat; oder um im Schwimmbad kurz abzutauchen. Tatsächlich leistet die ehemalige Verkäuferin, die sich derzeit in Familienhospizkarenz befindet, den Löwenanteil von Jennys Betreuung: Sie verabreicht ihrer Tochter das Essen, absolviert die Körperpflege im Bett, weil die Dusche im ersten Stock unerreichbar ist, wechselt Infusionen und wuchtet den 40 Kilo schweren Körper in den Rollstuhl. "Aber ohne Unterstützung“, sagt die resolute Frau, "würde es nicht gehen.“
Es war vor knapp sechs Monaten, als Jenny von der Universitätskinderklinik im Wiener AKH als "austherapiert“ entlassen wurde, wie es im Medizin-Jargon so zynisch heißt. Fast zwei Jahre hatte sie hier verbracht, teils stationär, teils in der Tagesklinik, in die sie ein Fahrtendienst brachte. Drei Operationen musste Jenny über sich ergehen lassen und eine Chemotherapie überstehen - bis es im Dezember 2012 keine Hoffnung mehr gab. "Jenny wird bald sterben“, sagten die Ärzte zum Abschied. Doch was heißt "bald“? "Vor allem diese Unbestimmtheit hat mich wütend gemacht“, erinnert sich Christine S.
Vielleicht wäre sie damals verzweifelt, wenn es dieses helfende Netz nicht gegeben hätte: Diese Krankenschwestern des Vereins Mobile Kinderbetreuung (MOKI), die ihr nach der Spitalsentlassung die wichtigsten Pflegeschritte erklärten und bis heute dienstags, donnerstags und samstags ins Haus kommen; diese Familienhelfer der Caritas, die sie im Haushalt unterstützen; und natürlich Julia Kovacs, die jeden zweiten Samstag Jennys Schmerztherapie anpasst, Blutproben nimmt oder Katheternadeln wechselt. Die gebürtige Ungarin, die 20 Jahre lang auf der onkologischen Station des St. Anna Kinderspitals als Anästhesistin tätig war, ist neben Brigitte Humer-Tischler die zweite Ärztin im Team des "Kinderhospiz Netz“. Bis vor kurzem hat Kovacs noch ein zweites, krebskrankes Mädchen medizinisch versorgt. Vor zwei Wochen ist es verstorben.
Jenny S. jedoch lebt: trotz aller düsteren Prognosen, trotz dieser bösen Zellen in ihrem Kopf. Dass sich der Tumor nicht vergrößert hat, obwohl die 14-Jährige keine Chemotherapie durchläuft, lässt ihre Familie und sie selbst hoffen. Vielleicht hat sie sogar Kraft genug, ab Herbst im Rahmen einer "basalen Förderklasse“ wieder die Schule zu besuchen. "Jenny weiß jedenfalls über ihre Situation Bescheid“, sagt ihre Mutter. "Manchmal sagt sie: Ich sterbe! Dann wieder: Sicher nicht!“ Vor allem die Blindheit mache ihr zu schaffen: Erst kürzlich sei eine Freundin mit einem Neugeborenen zu Besuch gekommen, erzählt Jennys Mutter. "Dass sie dieses Baby nicht sehen konnte, das war wirklich hart.“
Christine S. selbst hat im Laufe der Jahre begonnen, "viel zu verdrängen und in den Tag hinein zu leben“. Sie freut sich, wenn Jenny im Rollstuhl die Zehen bewegt oder lustvoll reimt; sie freut sich über die Videos vom dreiwöchigen Aufenthalt im burgenländischen Kinderhospiz "Sterntalerhof“, wo ihre Tochter lächelnd auf einem Pferd gesessen ist oder einer Ziege das Grünzeug weggeknabbert hat; sie freut sich auf das baldige Picknick aller betreuten Familien des mobilen "Kinderhospiz Netz“ am Badeteich Hirschstetten - und vor allem auf Mihaela Rusu und Gabriele Knapp, die beiden unbezahlbaren Ehrenamtlichen.
Wenn die Freude schwindet und die Trauer allzu mächtig wird, dann schaut sie auf das große, bunte Bild, das über Jennys Bett im Wohnzimmer hängt: "Alleine sind wir stark…“ ist darauf zu lesen. "Zusammen sind wir stärker!“
Nähere Infos: www.kinderhospiz.at

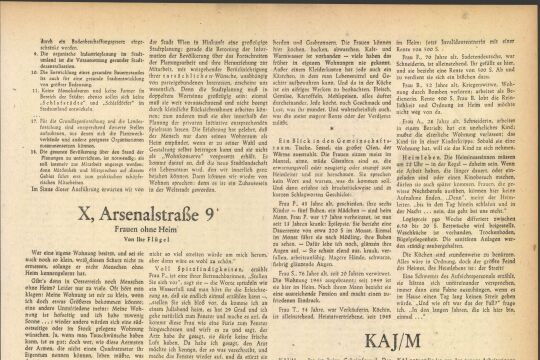












































.jpg)







