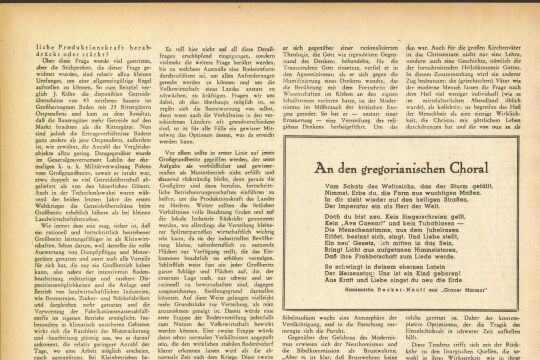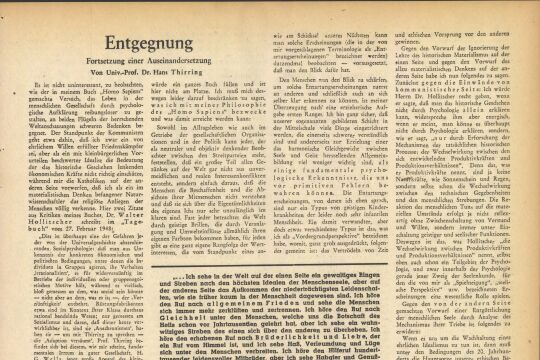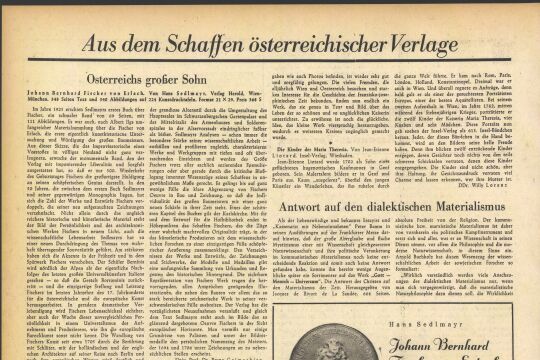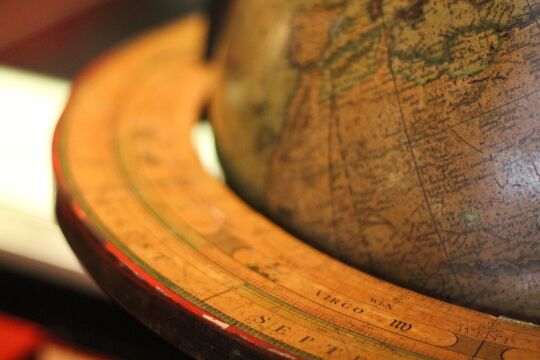Diese Frage behandelt Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Religionsphilosophin an der TU-Dresden, in ihrem Vortrag bei der Stadtmission und im folgenden Gespräch.
Die Furche: Die Nachfrage nach Sinn scheint zu steigen. Wie steht es mit Sinn-Angeboten?
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Der etwas ausgefranste Begriff Postmoderne versucht das Reden von einem Sinn herunterzuspielen. Sinn gibt es nicht, heißt es da. Wenn, dann machen wir Sinn, abrufbare, aber auch wieder kündbare Sinnentwürfe. Natürlich hängt diese proklamierte Sinnleere auch damit zusammen, dass der Gottesbegriff immer dünner wird. Andererseits, so meine These, können wir heute eine wachsende Umkehr unter deutschen, französischen und italienischen Postmodernisten beobachten.
Die Furche: An wen denken Sie da konkret?
Gerl-Falkovitz: In Deutschland war es Jürgen Habermas, der nach dem 11. September 2001 gesagt hat, dass Philosophie nie Religion ersetzen oder kompensieren kann. Ein starker Satz für einen Philosophen, der aus der Frankfurter Schule kommt. Auch Botho Strauß und Gianni Vattimo (vgl. Furche 20, S. 10, Anm.) bauen intensiv ein Verhältnis zur Religion auf. Für Frankreich möchte ich Jacques Derrida nennen, ein Agnostiker. Er hat eine wunderbare Aussage getroffen. Im Sozialsystem, so Derrida, verzeihen wir einander die verzeihlichen Sünden, die kleineren Vergehen. Eine Gesellschaft könne aber nur leben, wenn es eine Instanz gibt, in der das Unverzeihliche verziehen wird. Diese Instanz gibt es nicht in der Gesellschaft . Er formuliert es im Konjunktiv. Herauskommt aber: Nur im Absoluten gibt es Absolution. Bemerkenswert, dass solche Überlegungen nicht aus dem Raum der Kirche kommen, sondern aus dem führender Intellektueller.
Die Furche: Von woher kann sich Ethik in einer pluralistischen Welt die Legitimation herholen?
Gerl-Falkovitz: Ich sehe da zwei Quellen. Die erste ist eine philosophische, die zweite eine biblische. Was die Antike entwickelt hat, ist das Wort Maß. Es geht um die Angemessenheit unseres Tuns. Wir können weit mehr, als wir unmittelbar lebensweltlich ausreizen. Das wusste schon die Antike. Die Frage ist: Was ist dem menschlichen Leben eigentlich heilsam? Es gibt Momente, wo wir zu wenig oder zu viel tun. In beiden Fällen rutscht das Leben in eine Destruktion ab.
Die Furche: Was fügt die biblische Quelle dem hinzu?
Gerl-Falkovitz: In dem Moment, wo ich dem Menschen ein Pendant gegenüber stelle, seinen Schöpfer, ist er zur Selbstreflexion verpflichtet. Die Frage nach dem Rechten ist hier nicht vom eigenen Maß her definiert, sondern von der Frage: Wer hat mich befugt, etwas zu tun? Die erste Frage könnte ich ja noch mit Autonomie lösen. Aber auch in der Autonomie haben wir Grenzen. Die zweite Frage lautet: Wenn ich geschaffen bin, muss ich fragen, inwieweit mir die Schöpferkraft verliehen ist, um selbst schöpferisch zu sein. Und: Ab wann wird es destruktiv?
Die Furche: Und was, wenn man weder die Antike noch die biblische Tradition benutzen will?
Gerl-Falkovitz: Dann könnte man schlicht und einfach empirisch arbeiten. Ohne jede moralische Wertung müssen wir sagen, dass wir zu einer Destruktion der jetzigen und der nächsten Generationen fähig sind. Die Frage ist: Wollen wir das tun? Es werden ja immer nur funktionale Argumente angeführt. Man sagt, "um anderes Leben zu retten". Aber das ist ja ein Zirkelschluss. Das hat Kant schon längst aufgedeckt.
Die Furche: Wäre ein kleinster gemeinsamer ethischer Nenner tragfähig?
Gerl-Falkovitz: Ich stehe Küngs Weltethos-Konzept kritisch gegenüber. Es hat nämlich den Nachteil, dass man mit ihm nicht über die Goldene Regel (Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu) hinauskommt. Die eigentlichen Probleme liegen ja gar nicht darin, dass man dem anderen schaden will, sondern dass die Definition von Schaden und Nutzen weit unterhalb der Goldenen Regel auseinander läuft. Wir sollten nicht über Weltethos sprechen, sondern jede Kultur und jede Religion beauftragen, sich zu präzisen Fragen präzise zu äußern. Etwa die Frage, ob wir Klonen verbieten sollen. Das sieht bei einem Buddhisten anders aus als bei einem Christen. Wie steht ein Hindu, der an Wiedergeburt glaubt, zur Euthanasie? Die eigentliche Arbeit besteht nicht darin, allgemeine Maschen zu formulieren, sondern wie wir heute mit konkreten Problemen in einer kleinerteiligen Kultur, einer europäischen, einer asiatischen, umgehen.
Die Furche: Läuft das nicht auf Konfrontation hinaus?
Gerl-Falkovitz: Nein, sondern auf Klärung. Wenn Sie heute einen Buddhisten fragen, was er vom Klonen hält, fällt ihm erstmal wenig dazu ein. Die Meinungsführung liegt ja nach wie vor in der westlichen Welt. Auch "Weltethos" ist ja eine europäisch-amerikanische Erfindung. Insofern sehe ich eine Ungleichzeitigkeit: wir preschen vor mit unseren Konzepten in der Meinung, für alle zu sprechen, übersehen aber, dass die anderen möglicherweise gar nicht daran interessiert sind oder noch gar keine Meinung zu bestimmten Problemen haben.
Die Furche: Im Zuge der Debatte um eine EU-Verfassung wird über einen Gottesbezug in die Präambel debattiert. Wäre dieser ein Fortschritt?
Gerl-Falkovitz: Auf jeden Fall. Vor allem deshalb, weil die Präambel der europäischen Verfassung ja keine globale Präambel ist. Sonst wäre es anders. Aber Europa ist ein Kontinent, der sich aus einem klar fundierten religiösen Anspruch heraus entwickelt hat.
Die Furche: Bedroht das nicht den säkularen Charakter des Staates?
Gerl-Falkovitz: Die klare Gewaltenteilung ist ja gerade das Ergebnis des biblischen Kontextes! Gerade deshalb finde ich den biblischen Anschluss so wichtig. "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist" ist eben gerade keine Theokratie. Ich denke, der Verweis auf Gott in der Präambel ist ja kein Verweis, der Menschen zwingt, daran zu glauben. Er hat eine Erinnerungsfunktion: Europa kommt aus diesen historischen Wurzeln. Außerdem glauben 80 Prozent der Europäer an Gott. Auch von daher ist es völlig gerechtfertigt, diesen Bezug zu nennen.
Das Gespräch führte Susanne Kummer.